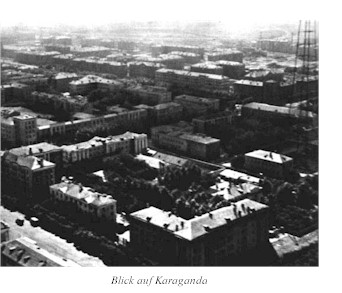История Россия-немецких
8 Культурный архив
8.2.5 Дороги судьбы - воспоминания
8.2.5.3.22 Viktor Heidelbach
Viktor Heidelbach wurde 1926 in Straßburg, im Kanton Pallasowka der Deutschen Wolgarepublik, als drittes von vier Kindern geboren. Sein Vater arbeitete als Kutscher bei der Landvermessung und später als Kolchosbauer. Seine Mutter war Näherin.
1935 verließ die Familie das Wolgagebiet und zog nach Kirowobad in Aserbaidschan. Der Vater fand dort ebenfalls in einem Kolchos Beschäftigung.
Aufgrund der Erkrankung der Mutter an Tropenfieber siedelten die Heidelbachs 1938 erneut um, diesmal in die Stadt Armawir im Gebiet von Krasnodar. Der Vater verdiente dort sein Auskommen mit dem Entkernen von Sonnenblumen und dem Verkauf von Sonnenblumenkernen.
Die Deportation aller Familien deutscher Nationalität aus Armawir war für den 8. Oktober 1941 angesetzt. Dieses Datum wurde meinem Vater und den anderen schon etwa vier Wochen vorher mitgeteilt. Wir hatten also ein bisschen Zeit zur Vorbereitung auf den Abtransport. Aber es gab nicht viel vorzubereiten. Wir durften ja nur das Wenige mitnehmen, was wir tragen konnten. Es war u. a. nicht erlaubt, Vieh zu schlachten und größere Essenvorräte anzulegen. Mutter trocknete in diesen Tagen immer wieder Brot. Zwieback war haltbar und immer zu gebrauchen. Meinem Vater gelang es nach längerem Hin und Her mit den Verantwortlichen der Stadt, doch noch die Erlaubnis zum Schlachten unseres Schweines zu erhalten. Das Fleisch wurde gekocht und gebraten, in Eimer gelegt und mit Schmalz übergossen. So blieb es für einige Zeit haltbar; und wir hatten wenigstens einen kleinen Vorrat für die Fahrt ins Ungewisse.
Die Fahrt nach Kasachstan dauerte 41 Tage. Wir saßen dichtgedrängt im Güterwaggon, knapp 100 Personen. Der Zug schleppte sich langsam nach Osten.
Oft hielt er für längere Zeit, mal auf Bahnhöfen, mal auf freier Strecke. Ich erinnere mich noch daran, dass wir einmal volle drei Tage auf einem Bahnhof standen. Aus der Gegenrichtung Veröffentlichung des Erlasses zur Deportation der Russlanddeutschen kam ein Zug nach dem anderen mit Soldaten für die Westfront. Obwohl ich erst 15 Jahre alt war, begriff ich, dass etwas ganz Außergewöhnliches im Land vor sich ging, der Krieg plötzlich alles verändert hatte und nichts mehr so sein würde wie zuvor. Wir verließen den engen und verlausten Waggon. Die Frauen kochten auf zusammengestellten Steinen neben den Gleisen etwas Warmes zum Essen. An manchen Orten wurde auch Brot und Suppe verteilt, doch das reichte nicht zum satt werden, wenn wir nicht noch unsere Vorräte gehabt hätten. Die Fahrt schien kein Ende zu nehmen und die Läuse waren nicht zu besiegen. Die Tage wurden auch für die Kinder und uns Jugendliche, für die zu Beginn alles noch einen Hauch von Abenteuerlichkeit hatte, immer schwerer und unerträglicher.
Am 19. November waren wir endlich am Ziel. Wir konnten in Kustanai in Kasachstan den Zug verlassen. Auf dem Bahnhof standen eine große Menge von Pferdefuhrwerken, die uns Deportierte in einzelne Dörfer dieses Gebietes brachten. Es herrschte bereits starker Frost und es lag schon hoher Schnee. Das Dorf, das uns zugewiesen war, lag 150 km von Kustanai entfernt.
Zum Glück lag auf dem Kastenwagen, mit dem unsere Familie abtransportiert wurde, genügend Heu und Stroh. Mutter und wir drei Kinder konnten uns darin fast unsichtbar verkriechen und uns so vor der grimmigen Kälte wenigstens etwas schützen. Nur Vater trug einen Pelz und nahm neben dem Kutscher Platz. Wir waren zweieinhalb Tage unterwegs. In der Nacht machten wir in Siedlungen Halt. Der Empfang war reserviert, aber nicht feindlich. Im Gebiet lebten vor allem russische Kulaken, die im Zuge der Kollektivierung der Landwirtschaft in der Sowjetunion am Ende der 20er und am Anfang der 30er Jahre in das kasachische Neuland verbannt worden waren. Uns betrachtend, sagten sie zu uns halb im Ernst und halb im Scherz: "Ihr habt ja gar keine Hörner an Euren Köpfen, wie ihr Deutschen uns jetzt im Krieg als Feinde beschrieben werdet." Sie gaben uns Unterkunft und Essen. Offenbar wussten sie, was Deportation und Verbannung bedeuteten, welchen Anfeindungen und Beschimpfungen man da ausgesetzt ist.
In Nekrassowka, einer Siedlung mit etwa 150 Bewohnern, wurden wir zuerst bei einer russischen Familie einquartiert. Nach einiger Zeit besserten wir ein leer stehendes, ziemlich heruntergekommenes Haus aus und teilten es uns mit einer deutschen Familie, die ebenfalls deportiert war. Die Leute von Nekrassowka bildeten eine Brigade eines großen Kolchos, der aus mehreren anderen Siedlungen und Brigaden bestand. Vater hatte Glück; er konnte als Buchhalter in der Brigade arbeiten. Im Kolchos betrieb man Viehzucht - Kühe, Pferde und Schweine - und man baute Weizen und Roggen an.
Meine Kindheit war nun abrupt beendet. Ich musste mit meinen 15 Jahren wie alle anderen im Kolchos arbeiten. Schnell lernte ich die Arbeit in der Landwirtschaft und den Umgang mit Tieren. Im Winter 1941/42 hatte ich Heu auf einem mit zwei Ochsen bespannten Schlitten zur Fütterung der Rinder zu fahren. Im Sommer 1942 wurden mir dann zwei Pferde anvertraut, mit denen ich Gras mähte. Tag ein Tag aus, vom frühen Morgen bis zum späten Abend war ich draußen auf den Wiesen und hatte immer das Gleiche zu tun. Es war anstrengend. Doch in mir fühlte ich auch ein bisschen Genugtuung und Stolz, schon wie ein Erwachsener arbeiten zu dürfen.
Im Februar 1942 wurde bereits der Sohn unserer Nachbarn, ebenfalls Deutscher, in die Trudarmee eingezogen. Er war Mitte zwanzig.
Am 15. November erhielten wir, mein Vater und ich, den Befehl. Zwei Tage später wurden wir mit dem Schlitten nach Urisk gebracht. Man nahm uns die Ausweise ab. Und weiter ging die Fahrt nach Kustanai, wo wir am folgenden Tag in einen Güterzug verfrachtet wurden. Am 27. November 1942 sind wir dann in Karaganda angekommen. Auch den letzten von uns wurde nun klar, was uns bevorstand: Zwangsarbeit in den dortigen Steinkohlegruben.
Die Bewohner des Dorfes Tichonowka hatte man kurzerhand ausquartiert und ihre Häuser für uns als Lager umfunktioniert. Die etwa 50 Häuser im Lager befanden sich an zwei Straßen. Stacheldraht, Wachtürme und militärische Bewachung umgaben nun das Dorf. Jedes Haus hatte vier Eingänge. Die Räume waren dicht mit Pritschen bestückt, in jeweils drei Etagen. Die Pritschen bestanden aus Holzbrettern. Dort gab es keinen Strohsack, keine Decke und kein Kopfkissen. Wir legten uns mit den Sachen nieder, wie wir sie tagsüber trugen. Mehr wurde uns nicht gewährt.
Etwa 1 000 Mann befanden sich im Lager. Nach der Ankunft kamen wir ins Badehaus und man schor uns die Köpfe kahl. Wir sollten uns offenbar nicht von Sträflingen unterscheiden. Es gab Arbeitssachen, eine Jacke und Hose sowie Holzschuhe. Und sSchachtanlage in Karagandachon am nächsten Tag ging es in die Grube. Man zeigte uns kurz die Arbeit und dann galt es, die Tagesnorm zu schaffen. Zuerst war es furchtbar schwer. Niemand von uns kannte die Arbeit unter Tage. Wir mussten uns oft bis zur fast völligen Erschöpfung verausgaben. Erst nach und nach gewöhnten sich die meisten von uns an die schwere Arbeit. Viele schafften es nicht; sie wurden krank und starben.
Zu der Knochenarbeit im Schacht kam noch, dass sich das Lager sieben Kilometer von der Grube entfernt befand. Das bedeutete, wir mussten zweimal am Tag, vor und nach der 10-Stunden-Schicht, den Weg zu Fuß zurücklegen. 14 Stunden dauerte der Arbeitstag also, An- und Abmarsch und die Arbeit im Schacht. Es war eine elende Plackerei, und das jeden Tag ohne einen Tag der Erholung. Erst im Oktober 1943 wurde es etwas leichter, als das von uns errichtete neue Lager, das nur 700 Meter von der Grube entfernt war, fertig wurde.
Verpflegung gab es zweimal am Tag, am frühen Morgen und am späten Abend: Nudeln, Makkaroni, eine Suppe oftmals mit grünen Tomaten und zuweilen auch ein bisschen Fisch darin - das war unsere tägliche Verpflegung. Früh gab es auch noch die Brotration für den Tag. Wir aßen sie meistens gleich auf. Einmal wollte ich mir etwas für den Abend aufsparen.
Doch als ich aus der Grube zurückkehrte, hatte man mir das Stück Brot gestohlen. Sicherlich war unsere Verpflegung im Bergbau besser als in anderen Arbeitslagern. Doch satt essen konnten wir uns dennoch nicht. Ich war meistens hungrig. Nur ganz kurz stellte sich nach dem Essen in der Stolowaja ein Sättigungsgefühl ein.
Ich war erst 16 Jahre alt. Doch danach fragte niemand. Ich musste um mein Überleben kämpfen, meinen Mann stehen, wie die Erwachsenen. Da gab es keine Nachsicht. Zum Anfang war Vater da. Wir waren im gleichen Lager und in der gleichen Grube. Doch Vater hatte ein wenig Glück im Unglück. Seit seiner Jugendzeit, als er mal vom Pferd fiel, hatte er einen Leistenbruch. Trotz zweier Operationen konnte ihm nicht geholfen werden. Nun, bei der schweren Arbeit im Bergwerk, verschlechterte sich sein Leiden sehr. Der Arzt im Lager untersuchte ihn und entschied dann, dass er nicht arbeitsfähig sei. Vater wurde 1943 aus dem Lager entlassen und konnte zurück zu meiner Mutter nach Nekrassowka fahren. Für ihn war das gut. Ich hingegen verlor eine Stütze und musste mich fortan allein durchbeißen.
Von zu Hause aus Nekrassowka kamen bald schlechte Nachrichten. Mein Bruder Oskar befand sich bei Kriegsausbruch in der Roten Armee. Sein Regiment stand an der Westfront in der Ukraine. Wie alle Armeeangehörigen deutscher Nationalität wurde er jedoch kurz nach Kriegsbeginn entlassen und in ein Arbeitslager nach Archangelsk geschickt. Im Sommer 1943 kam sein letzter Brief an die Eltern. Er schrieb, dass es ihm furchtbar schlecht ginge und er am Verhungern wäre. Er bat um etwas zu essen. Vater machte ein Esspaket fertig. Doch auf der Post nahm man es ihm nicht ab. Angeblich waren die Verbindungen wegen der deutschen Belagerung von Leningrad in den Norden unterbrochen. Vater und Mutter waren verzweifelt, dass sie ihrem Sohn nicht helfen konnten. Wir haben von meinem Bruder seitdem - auch nach dem Krieg von offizieller staatlicher Seite - nie mehr etwas gehört.
Hart traf mich die Nachricht vom Tod meiner Mutter. Sie starb am 14. November 1943. Zwei Tage zuvor hatte sie miterleben müssen, wie Elvira, ihre Tochter und meine Schwester, auch in die Trudarmee geholt wurde. Meine Schwester kam übrigens auch in ein Lager nach Karaganda und musste wie ich in einer Steinkohlengrube arbeiten.
Die Arbeit in der Grube war, wie schon gesagt, besonders in der Anfangszeit für uns sehr schwer. Ich musste beim Grubenausbau arbeiten. Die Firste (Deckenflächen) und die Stöße (Seitenflächen) der Stollen und Schächte wurden mit Holz als Ausbaumaterial abgestützt. Oft gab das Holz dem Gebirgsdruck nach und wir mussten es reparieren oder erneuern. Das war auch eine gefährliche Sache.
Einmal stürzte das Ausbaumaterial unmittelbar in unserer Nähe ein. Zum Glück gelang es mir, zwei Kollegen, die verschüttet und verletzt waren, zu retten. Im Juni 1945 gab es in einer Nachbargrube eine Explosion. 66 Kollegen kamen dabei zu Tode. Und im April 1948 ereignete sich ein Brand in der Grube, in der ich arbeitete. Auch da starben viele Bergleute und Kriegsgefangene. Ich hatte dabei Glück. Zehn Tage zuvor hatte ich einen Unfall. Ich geriet zwischen zwei Hunte und erlitt eine Quetschung. Der Brand brach in der Nachtschicht aus. Zur Frühschicht sollte ich wieder die Arbeit aufnehmen. Vielleicht hätte es auch mich damals erwischt.
Ab 1943 kamen immer mehr Kriegsgefangene, deutsche, rumänische, ungarische und auch japanische, nach Karaganda. Sie mussten auch in der Grube unmittelbar beim Abbau der Kohleflöze arbeiten. Obwohl es verboten war oder zumindest nicht gern gesehen wurde, unterhielten wir uns mit den deutschen Kriegsgefangenen. Wir waren Kollegen und hatten ein ähnliches Schicksal. Das war stärker als alles andere. Wir einfachen Leute wollten den Krieg nicht und wurden zu Dingen gezwungen, die außerhalb unserer Entscheidung lagen.
Als der Krieg zu Ende war, glaubten auch wir Trudarmisten, dass wir nun wieder zu unseren Familien oder vielleicht sogar in unsere Siedlungen vor der Deportation 1941 zurückkehren könnten. Doch wir mussten bleiben. Es begann die Zeit der Kommandantur für uns Russlanddeutsche. Wir mussten weiterhin in der Grube arbeiten und durften Karaganda nicht verlassen. Trotz dieser erneuten Diskriminierung veränderte sich das Leben doch allmählich zum Besseren. Wir bekamen nun Lohn, konnten uns wieder satt essen und in der Stadt frei bewegen. Aus heutiger Sicht mag das sicherlich als wenig erscheinen, doch damals nach den dunklen Kriegsjahren war es etwas, das uns neuen Auftrieb gab.
1948 habe ich Emma Freis, auch eine Russlanddeutsche, geheiratet. Sie war mit meiner Schwester zusammen im Arbeitslager. Auch nach der Trudarmee hat sie weiterhin wie ich in der Kohlengrube gearbeitet. 1948 und 1950 wurden unsere Söhne Wladimir und Alexander und 1953 unsere Tochter geboren.
Wir verdienten im Bergwerk gut und wir waren sparsam. So konnten wir uns bald ein eigenes Haus bauen. Es hatte zwar nur zwei Zimmer, doch es reichte, wir waren ja nicht anspruchsvoll. Später haben wir uns dann an anderer Stelle ein größeres Haus gebaut. Es hatte vier Zimmer, Küche, Bad und eine geräumige Veranda. Wir mussten allerdings das Haus nach einigen Jahren aufgeben. Das ganze Gebiet, wo es stand, senkte sich aufgrund des Grubenvortriebs ab und musste geräumt werden. Wir zogen dann in die Drei-Zimmer-Wohnung eines Hochhauses.
Ich wollte meinen Vater und seine Frau (er hatte sich inzwischen wieder verheiratet) zu uns nach Karaganda holen. Zuerst führte da kein Weg hin. Die örtlichen Behörden lehnten den Antrag ab. Ich habe dann einen Brief nach Moskau geschrieben und mein Anliegen ganz oben bei der Regierung bekräftigt. Und ich hatte Erfolg. Nach zwei Wochen kam ein positiver Entscheid. Vater und Stiefmutter konnten 1948 zu uns nach Karaganda umziehen. Auf dem Hof unseres Grundstückes errichtete ich für sie einen kleinen Anbau.
Manchmal werde ich gefragt, warum wir nach Aufhebung der Kommandanturzeit 1955/56 in Karaganda, dem Ort des Arbeitslagers, geblieben und nicht irgendwo anders hingezogen sind. Wohin sollten wir gehen? Eine gute Arbeit und eine ordentliche Wohnung zu finden war in der Sowjetunion immer ein großes Problem. Gewiss, die Arbeit im Kohlebergwerk war auch nach dem Krieg mit modernerer Technik schwer und gefährlich. Doch als Bergleute gehörten meine Frau und ich zu den angesehensten Arbeitern im Lande. Der Verdienst lag weit über dem Durchschnitt. In Karaganda hatte sich im Laufe der Jahre ein vielfältiges kulturelles Leben entwickelt. Es gab keine Spannungen zwischen Russen, Deutschen und anderen Nationalitäten. Wir lebten dort nicht schlecht. Ich qualifizierte mich in der Grubenakademie zum Elektroschlosser. Mit dem Erreichen meines 50. Lebensjahrs 1976 bekam ich Rente. Doch ich habe noch bis 1991 weiter gearbeitet, nicht mehr im Drei-Schicht-Rhythmus, sondern nur noch in der Tagesschicht. Ich war von meinen 50 Arbeitsjahren 38 Jahre unter Tage. Ich glaube, das kann sich sehen lassen.
Leider waren unsere letzten Jahre in Karaganda von Krankheit geprägt. Meine Frau bekam Diabetes. Und bei mir verschlechterte sich das Augenleiden. Zuerst war nur die Hornhaut eines Auges betroffen, dann erkrankte auch das zweite Auge.
Die Operation brachte keinen Erfolg. Ich erblindete fast gänzlich. Auch der Zustand meiner Frau verschlechterte sich zusehends. Sie konnte sich aufgrund der Folgewirkungen der Diabetes nur noch mit Mühe fortbewegen. Nach der Wende und dem Zerfall der Sowjetunion wurde es in Karaganda und in Kasachstan immer schwieriger, die notwendigen Medikamente zu bekommen. Auch für unseren Sohn und unsere Tochter, die ebenfalls im Bergbau tätig waren, wurde die Situation immer komplizierter.
Monatelang gab es keinen Lohn und ihre berufliche Zukunft wurde immer ungewisser. Wir haben uns dann entschlossen, nach Deutschland überzusiedeln. Seit 1996 sind wir in Berlin.
Ich wurde hier in Deutschland erneut operiert. Und diesmal mit Erfolg. Es ist wie ein Wunder, dass ich wieder so sehen kann wie früher. Meiner Frau konnten die Ärzte leider nicht mehr helfen. Sie ist vor zwei Jahren verstorben.
Als Rentner geht es mir gut. Ich bin froh und dankbar, dass die Operation meiner Augen so gut geklappt hat. Für die jungen Leute ist es schon schwieriger, hier in der neuen Heimat zurecht zu kommen. Meine Tochter ist Buchhalterin. Trotz einer vom Arbeitsamt finanzierten Fortbildung ist es ihr bisher nicht gelungen, eine feste Arbeit zu bekommen. Ihr Mann hat glücklicherweise in einer Gießerei eine Stelle gefunden. Mein Sohn ist ebenfalls noch auf Arbeitssuche. Ich hoffe, dass er dabei bald Erfolg hat. Mein ältester Sohn ist nicht mit nach Deutschland gekommen. Er lebt mit seiner Familie in Kaliningrad.


 Etwa 1 000 Mann befanden sich im Lager. Nach der Ankunft kamen wir ins Badehaus und man schor uns die Köpfe kahl. Wir sollten uns offenbar nicht von Sträflingen unterscheiden. Es gab Arbeitssachen, eine Jacke und Hose sowie Holzschuhe. Und sSchachtanlage in Karagandachon am nächsten Tag ging es in die Grube. Man zeigte uns kurz die Arbeit und dann galt es, die Tagesnorm zu schaffen. Zuerst war es furchtbar schwer. Niemand von uns kannte die Arbeit unter Tage. Wir mussten uns oft bis zur fast völligen Erschöpfung verausgaben. Erst nach und nach gewöhnten sich die meisten von uns an die schwere Arbeit. Viele schafften es nicht; sie wurden krank und starben.
Etwa 1 000 Mann befanden sich im Lager. Nach der Ankunft kamen wir ins Badehaus und man schor uns die Köpfe kahl. Wir sollten uns offenbar nicht von Sträflingen unterscheiden. Es gab Arbeitssachen, eine Jacke und Hose sowie Holzschuhe. Und sSchachtanlage in Karagandachon am nächsten Tag ging es in die Grube. Man zeigte uns kurz die Arbeit und dann galt es, die Tagesnorm zu schaffen. Zuerst war es furchtbar schwer. Niemand von uns kannte die Arbeit unter Tage. Wir mussten uns oft bis zur fast völligen Erschöpfung verausgaben. Erst nach und nach gewöhnten sich die meisten von uns an die schwere Arbeit. Viele schafften es nicht; sie wurden krank und starben.

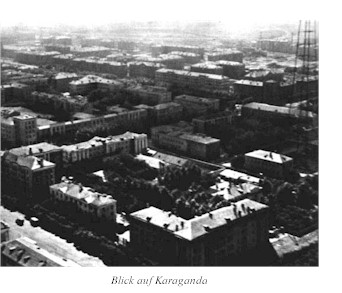 Die Operation brachte keinen Erfolg. Ich erblindete fast gänzlich. Auch der Zustand meiner Frau verschlechterte sich zusehends. Sie konnte sich aufgrund der Folgewirkungen der Diabetes nur noch mit Mühe fortbewegen. Nach der Wende und dem Zerfall der Sowjetunion wurde es in Karaganda und in Kasachstan immer schwieriger, die notwendigen Medikamente zu bekommen. Auch für unseren Sohn und unsere Tochter, die ebenfalls im Bergbau tätig waren, wurde die Situation immer komplizierter.
Die Operation brachte keinen Erfolg. Ich erblindete fast gänzlich. Auch der Zustand meiner Frau verschlechterte sich zusehends. Sie konnte sich aufgrund der Folgewirkungen der Diabetes nur noch mit Mühe fortbewegen. Nach der Wende und dem Zerfall der Sowjetunion wurde es in Karaganda und in Kasachstan immer schwieriger, die notwendigen Medikamente zu bekommen. Auch für unseren Sohn und unsere Tochter, die ebenfalls im Bergbau tätig waren, wurde die Situation immer komplizierter.