Auswanderung der Deutschen
Teil III 1917 - 1955
6. Die Nachkriegsentwicklung bis zur Auflösung des Sonderregimes für die Russlanddeutschen 1955
6.5 Gewaltsame Assimilation
6.5.1 Erlebnisse und Erfahrungen von Zeitzeugen
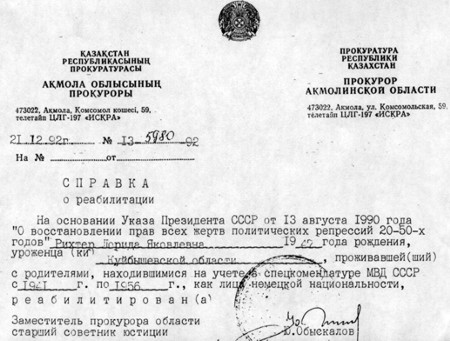
"... Adele Richter und ihre Tochter [Lora – d. Verf.] gingen 1952 nach Aufhebung der Arbeitsbindung in Sysran in den Ural, ins Gebiet von Swerdlowsk. Dort lebten Familienangehörige meiner Mutter. Unsere Leidenszeit war damit noch nicht beendet. Nur für kurze Zeit nahmen die Dinge einen guten Lauf. Mutter bekam Arbeit in einem Kindergarten. Sie kochte und nähte für die Kinder. Alle waren des Lobes voll über ihre Arbeit. Ich war nicht mehr allein und fühlte mich unter den anderen Kindern wohl. Der Kindergarten war einer der besten im ganzen Gebiet. Es sprach sich herum. Eines Tages kam der Vorsitzende des zentralen Dorfsowjets zur Besichtigung. Als er meiner Mutter begegnete und erfuhr, dass sie eine Deutsche sei, kam es bei ihm zu einem fürchterlichen Wutausbruch. ,Was, sie ist Deutsche? Wer hat es erlaubt, dass diese Person sich mit unseren Kindern abgibt? Raus mit dieser Faschistin, weg mit diesem deutschen Balg!' Mutter musste augenblicklich den Kindergarten verlassen und fortan in der Taiga beim Holzeinschlag arbeiten."
Frieda Reinhardt:
"Im Herbst 1945 kam ich in die Schule. Russisch konnte ich schon ein bisschen von der Hauswirtin und von den Dorfkindern. Doch sie sprachen einen Dialekt. Die Lehrerin wunderte sich. "Mein Gott, wie sprichst du denn. Das ist doch kein richtiges Russisch!" Die Lehrerin und die anderen Kinder halfen mir, so dass ich bald ordentlich die Sprache beherrschte. Nur in der Rechtschreibung hatte ich noch lange meine Mühe. Ich vergaß zuweilen Buchstaben oder verwechselte sie. Meine Schulkameraden hegten mir gegenüber keinen Hass. Wir kannten uns ja aus dem Dorf. Anders war das bei meinen Brüdern. Die wurden gleich nach der Deportation noch beschimpft und verdroschen. Sie konnten die Schule nicht fortsetzen. Bei mir ereignete sich nur einmal etwas in der 7. Klasse. Meine Mitschülerin Maria, die ich eines Tages nicht abschreiben lassen wollte, wurde plötzlich ganz wütend und schrie: "Du bist eine Faschistin, die man vergessen hat totzuschlagen." Ich war darüber sehr bestürzt. Meine Lehrerin hat diesen Vorfall gleich dem Direktor gemeldet. Dieser ist dann sofort in die Klasse gekommen und hat zu Maria und allen anderen gesagt: "Ich bitte euch, Kinder, macht das nie mehr. So etwas darf nicht geschehen!" Er hat erklärt, dass meine Familie während des Krieges aus dem Wolgagebiet wegmusste und nichts mit deutschen Faschisten und deren Verbrechen zu tun hätte. Maria musste mich vor der ganzen Klasse um Verzeihung bitten. Das war der einzige Zwischenfall, ansonsten hatte ich keine Probleme in der Schule."

"1955 beendete ich die 10. Klasse mit einer Goldmedaille. Ich habe immer zu den Klassenbesten gehört. Doch dieser Erfolg zum Abschluss erfüllte mich mit besonderem Stolz. Ich war damit berechtigt, ohne eine Aufnahmeprüfung ein Hochschulstudium aufzunehmen. Mein Wunsch war es, in Wilnius zu studieren. Dort trugen die Studenten Uni-Kleidung. Während der ganzen Kinder- und Jugendzeit musste ich immer armselige Sachen tragen. Jeder konnte sehen, dass wir uns zu Hause nicht viel leisten konnten und nur das Nötigste besaßen. Deshalb war mir eine einheitliche Kleidung wichtig, um an der Universität nicht gleich wieder aufzufallen. Leider stimmte die Kommandantur, die damals noch bestand, meinem Wunsch, ins Baltikum zu gehen, nicht zu. Stattdessen begann ich in Tula an der Pädagogischen Hochschule Mathematik und Physik zu studieren. Ich wollte Lehrerin werden.
In Tula blieb ich jedoch nur ein Jahr. Ausschlaggebend dafür waren zwei Ereignisse: Im Herbst vor Beginn des Studiums wurden wir wie alle Studenten in der Sowjetunion für einige Wochen zur praktischen Arbeit geschickt. Wir waren zum Ernteeinsatz im Kursker Gebiet. Wir halfen bei der Kartoffelernte. Eines Tages kamen zwei Milizionäre aufs Feld. Wie sich herausstellte, suchten sie mich, weil ich auf der Fahndungsliste gesuchter Personen stand. Ich hatte nicht beachtet, dass ich den Ernteeinsatz bei der Kommandantur hätte genehmigen lassen müssen. So suchten sie mich wie eine entlaufene Kriminelle. Nach längerem Hin und Her verzichteten die beiden Milizionäre darauf, mich festzunehmen und abzuführen. Sie beauftragten aber den Leiter unserer Gruppe und meine Kommilitonen, gut aufzupassen, dass ich, die Deutsche, mich nicht aus dem Staube mache. Das war, wie gesagt, im Herbst 1955. Ich verstand die Welt nicht mehr. In der Schule war ich die Beste gewesen, ich hatte die Goldmedaille erhalten. Und nun wurde ich als Bürgerin zweiter Klasse und als Studentin hingestellt, auf die die anderen ein wachsames Auge richten sollten.
Zu diesem Ereignis kam ein zweites. Wir hatten in Tula einen Dozenten, der es sich nicht verkneifen konnte, mich immer wieder in provokatorischer Weise auf meine deutsche Nationalität hin anzusprechen. Im Seminar machte er häufig solche Bemerkungen: "Und was für eine Meinung hat die deutsche Faschistin dazu?" Es klang äußerlich wie eine witzige Bemerkung, doch gleichzeitig steckte darin auch bitterer Ernst. Die anderen Studenten im Seminar lachten, niemand wandte sich gegen diese Worte des Dozenten. Mir reichte es, ich wollte mir all diese Dinge nicht mehr bieten lassen ...
Als ich 1956 meinen Personalausweis bekam und nun auch die Zeit der Kommandantur beendet war, ging ich mit meiner Schwester, die gerade die 10. Klasse abgeschlossen hatte, nach Nowosibirsk."
Viktor Ring:
"In diesem Dorf im Altai-Gebiet habe ich bis 1961 gelebt. Das Verhältnis zwischen den Russen und uns, den Russlanddeutschen, war besonders in dem Nachkriegsjahrzehnt sehr gespannt. Die Wunden waren tief. Die meisten russischen Familien hatten Angehörige im Krieg verloren. Pauschal wurden auch die Russlanddeutschen dafür mitverantwortlich gemacht. Ich habe das persönlich immer wieder in der Schule gespürt. Wir wurden als die "Fritzen" und die "deutschen Faschisten" beschimpft und angefeindet. Es kam zu Schlägereien. Wir deutschen Kinder und Jugendlichen hatten es schwer, uns durchzusetzen und Respekt zu gewinnen. Auch unsere Eltern hielten ihr "Deutschsein" zurück. Sie sprachen Deutsch nur zu Hause, nicht in der Öffentlichkeit und waren so bemüht, Auseinandersetzungen aus dem Weg zu gehen.
In dieser Situation habe ich schon sehr früh wahrgenommen, dass die Nationalität nicht nur mit bestimmten Traditionen – mit der Sprache oder der besonderen Art, Feste zu feiern – zu tun hat, sondern auch mit der politischen Vergangenheit und Gegenwart verknüpft war. Auch später, als ich in Kasachstan lebte, es diese Probleme im Zusammenleben nicht mehr gab und die Benachteiligungen der Russlanddeutschen mehr und mehr verschwanden, war ich mir immer meiner Nationalität bewusst. Das hinderte mich allerdings nicht daran, mit Russen, Kasachen und Vertretern anderer Nationalitäten enge und freundschaftliche Kontakte zu pflegen. Ich habe eine große Hochachtung gegenüber dem russischen Volk. Seine Kultur hat mich mitgeprägt. Daran gibt es keinen Zweifel. Auch jetzt, wo meine Familienmitglieder und ich deutsche Staatsbürger sind und in Berlin leben, verbinden uns noch sehr viele Erinnerungen, gute wie schlechte, mit Russland und Kasachstan. Die Nationalität ist wichtig, doch man sollte sie meines Erachtens aber auch nicht überbewerten."
(Kulturarchiv der Russlanddeutschen)